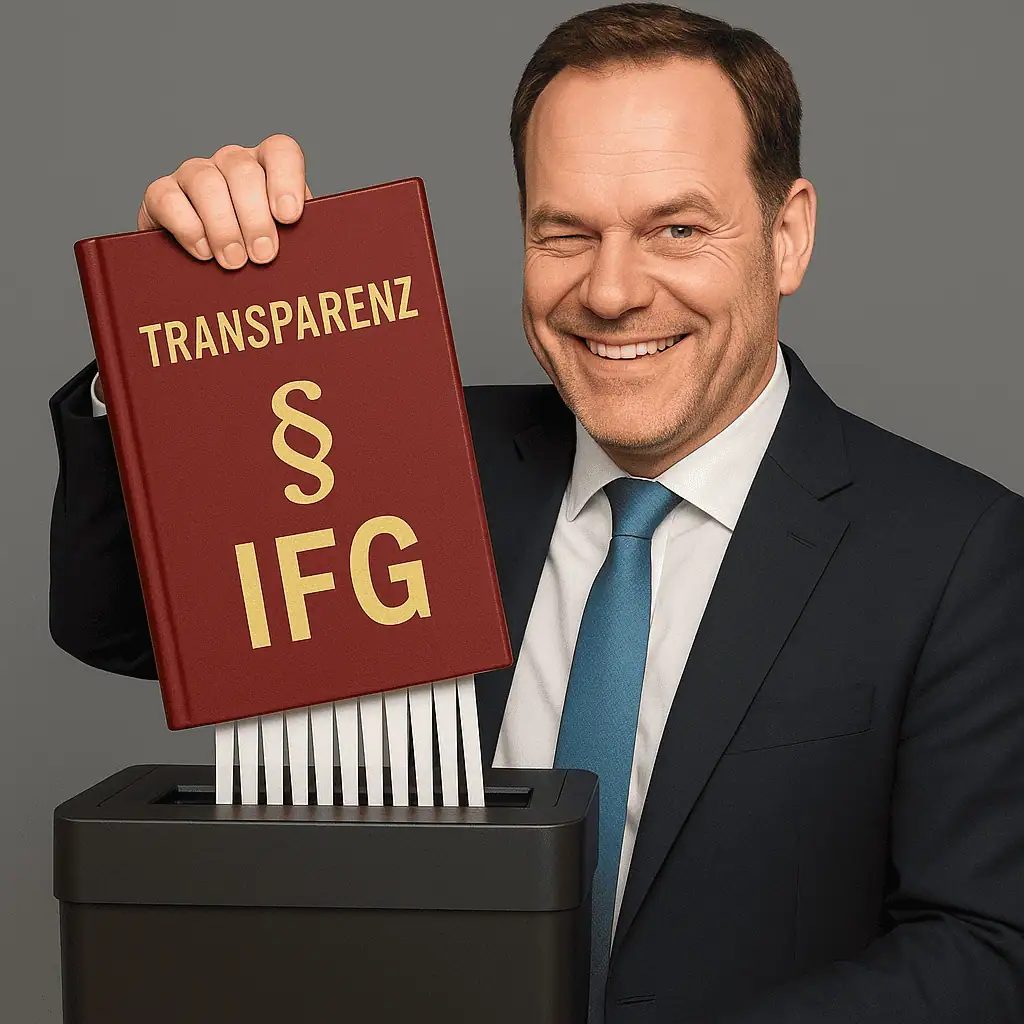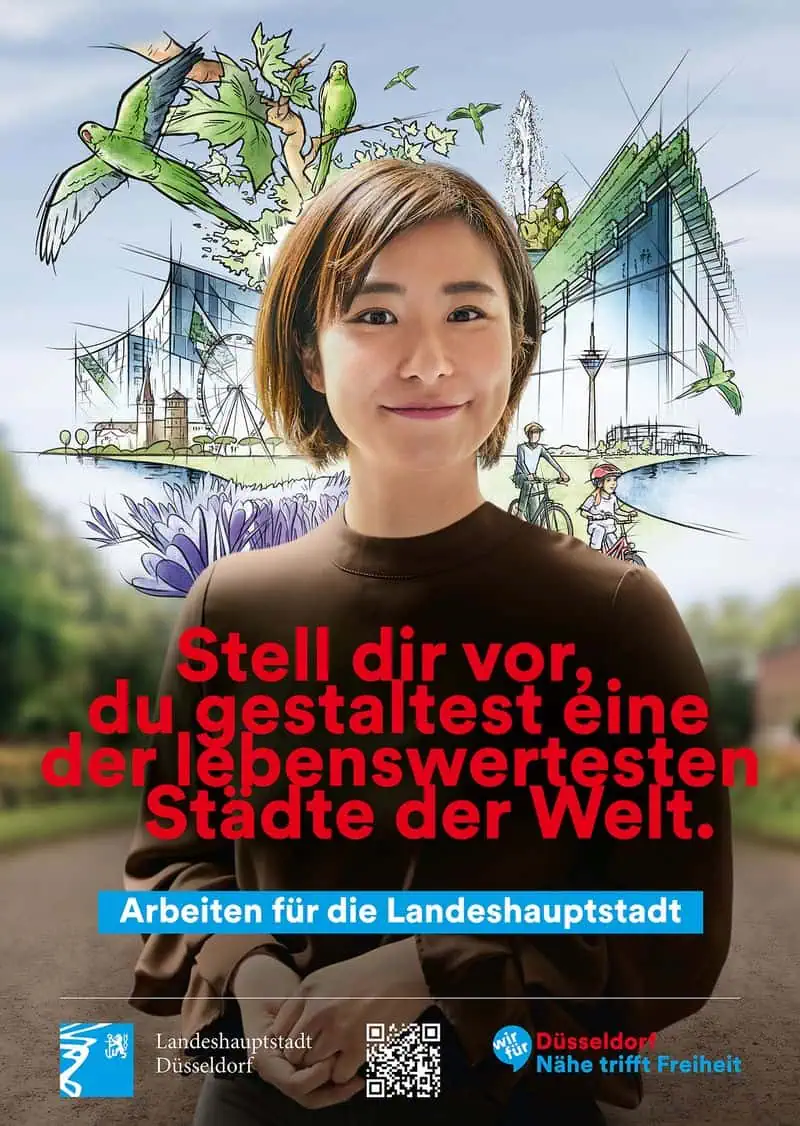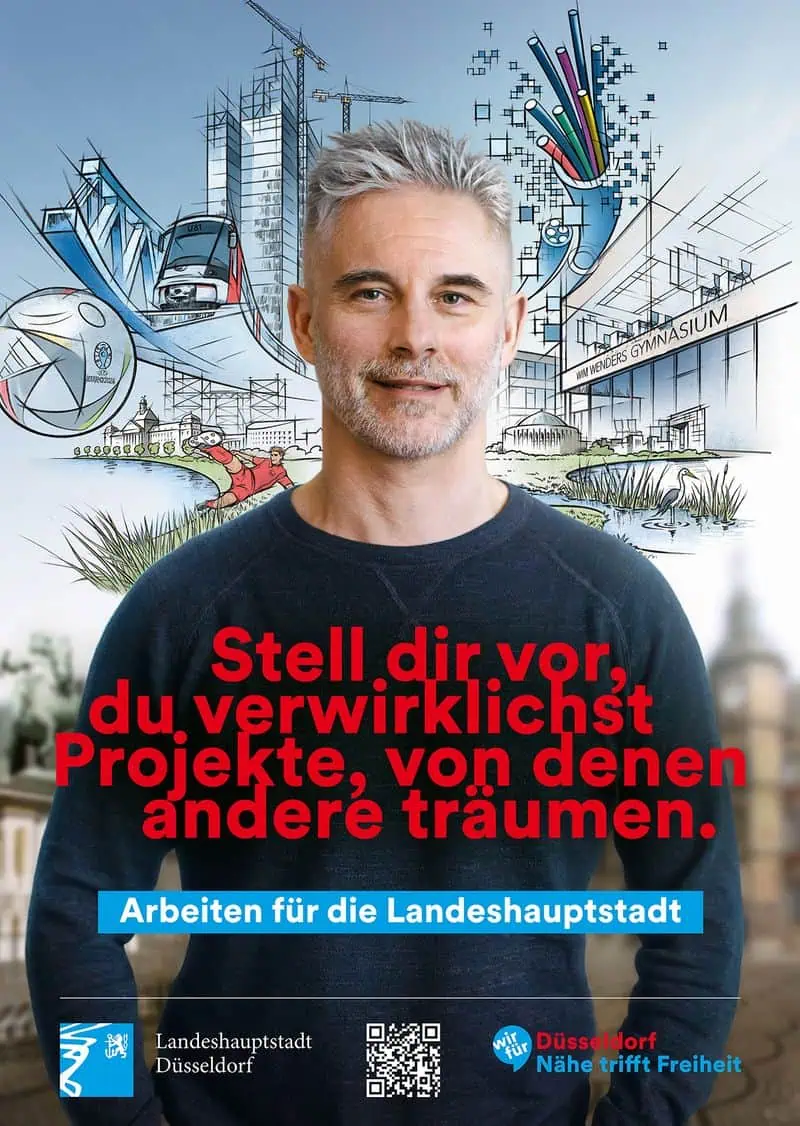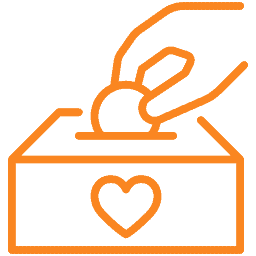Der geplante Immobilienkauf
In 2020 hat mich ein Freund beauftragt, ihm bei einem Immobilienkauf von der Stadt Düsseldorf zu helfen. Verkäufer war die stadteigene Tochter IDR AG, Objekt das Schloss Eller. Nach Ausschreibung und der Konzeptvorstellung bei Stadt und Bezirksvertretung fiel die Wahl auf uns. Zeitpunkt der Zusage knapp ein Jahr später – keine Rekordzeit, aber irgendwie im Rahmen. Aber die Geschichte aus Absurdistan beginnt hier erst:
Die Stadt wollte den Erbpachtvertrag nicht einfach so beibehalten, das Liegenschaftsamt und das Gartenamt wollten unbedingt Änderungen vornehmen. Nicht ganz ungewöhnlich und auch in Teilen irgendwie nachvollziehbar. Diese Verhandlungen mit dem Liegenschaftsamt zogen sich dann jedoch über die nächsten 4 (VIER !) Jahre. Einerseits, weil immer wieder neue Dinge bei der Due Dilligence auftauchten, auf die aber nicht hingewiesen wurde: Absinken des Gebäudes auf Grund von Untergrundveränderungen mit Sperrung von Terrassen, nicht genehmigte Parkplatzsituation, unzureichende Stromversorgung bei aktivem Betrieb der Immobilie mit Gastronomie, … Dinge, die geklärt sein sollten, bevor man eine Immobilie übernimmt. Andererseits aber vor allem auf Grund der Hinhaltetaktik, da es immer wieder hieß, dass man einen Vertragsentwurf vorbereitet und ihn ‚demnächst‘ zuschicken würde. Bis heute nicht passiert.
Entlang des Weges wurde mehrfach eskaliert: an den Referenten beim OB, an den Dezernenten beim OB, an die zuständige BV8, an die CDU, an mehrere Stadtratsmitglieder, an den Aufsichtsratsvorsitzenden der IDR, an die neue Referentin des OB, an die neue Dezernentin des OB, … Wir hatten viele Gespräche und viele Versprechungen, aber keine Hilfe. Anfang des Jahres hieß es dann Seitens der Stadt: „besteht nach unserer Einschätzung leider keine Aussicht auf Erfolg, die bereits seit Jahren andauernden Verhandlungen zu einem guten Abschluss zu bringen“.
Ja, wenn man das aktiv sabotiert, ist das bestimmt so. Abgesehen von dem finanziellen Verlust, den sie dadurch verursacht hat, verlieren der Stadtteil und die Bürger ein Leuchtturmprojekt, das vielen Freude gebracht hätte (von Gewerbesteuereinnahmen mal ganz zu schweigen). Ob dieses Verhalten der Außendarstellung der Stadt gerecht wird („Stell Dir vor Du verwirklichst Projekte, von denen andere träumen“), ist fraglich. Meines Erachtens ist es auf keinen Fall einer Landeshauptstadt würdig. Und so soll es halt nicht sein. Die Stadt hat Vorbildfunktion. Und diese muss sie halt professionell ausfüllen und nicht beleidigt schmollend die Figuren auf dem Spielplan umwerfen.
Quellenangabe Bild der Image-Kampagne